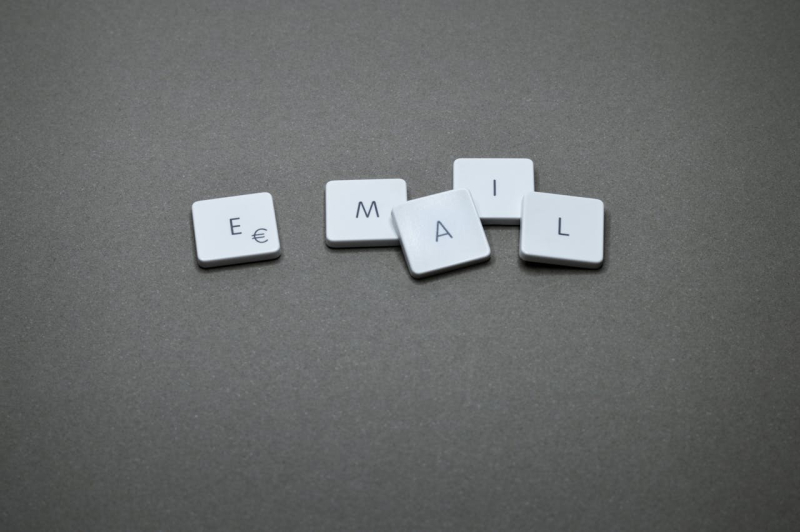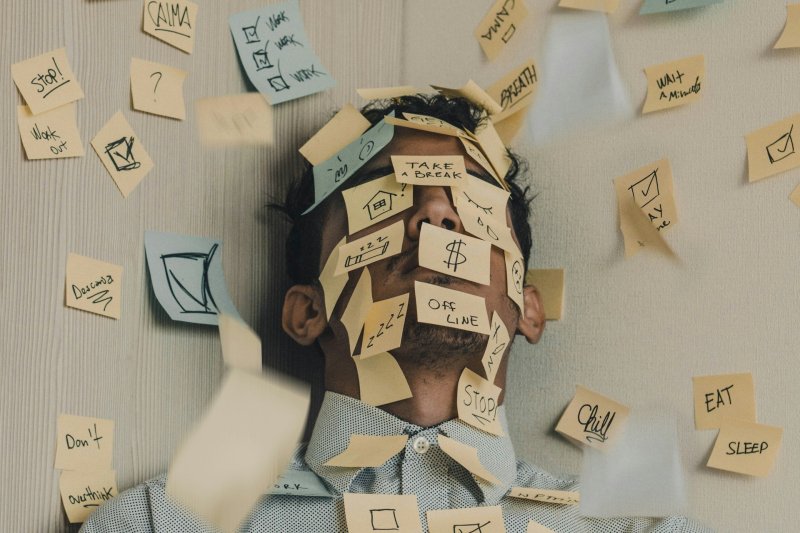Das Oberste Gericht befasste sich kürzlich mit der Frage, ob die Kündigung eines Mietvertrags für eine Wohnung gerechtfertigt ist, die der Mieter zur kurzfristigen Vermietung über Plattformen wie Airbnb nutzte.
Der Kläger war seit dem Jahr 2009 Mieter der streitgegenständlichen Wohnung. Aufgrund des Mietvertrages aus diesem Jahr war die Wohnung ausschließlich zu Wohnzwecken zu nutzen. Der Mieter war zudem berechtigt, die Wohnung oder Teile davon an andere Personen unterzuvermieten. Im April 2020 ersuchte der Kläger die Beklagte, aufgrund „der aktuellen Situation hinsichtlich der Schließung der Grenzen und der damit verbundenen Unmöglichkeit der Beherbergung von Touristen“ auf die Miete zu verzichten. Nach weiterer Kommunikation zwischen den Streitparteien und einer Besichtigung der Wohnung kündigte die Beklagte den Mietvertrag des Klägers gemäß Bestimmung § 2288 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, und zwar wegen einer groben Verletzung der Verpflichtung aus dem Mietvertrag, die in der Nutzung der Wohnung für geschäftliche Zwecke unter Verstoß gegen den Mietvertrag bestand.
Der Mieter entschied sich daher, gerichtlich feststellen zu lassen, dass die Kündigung ungerechtfertigt sei. Das mit dem betreffenden Rechtsstreit befasste Amtsgericht für Prag 1 kam dann zu dem Schluss, dass die Kündigung gerechtfertigt war und alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllte. Grund für die Kündigung war, dass der Kläger die Wohnung nicht dem vereinbarten Zweck, also zu Wohnzwecken, sondern zur kurzfristigen Vermietung an Touristen nutzte. Obwohl der Vertrag ihm die Untervermietung der Wohnung erlaubte, erfüllt eine kurzfristige Vermietung nicht den Zweck der "Erfüllung des Wohnbedarfs", und eine solche Vermietung widerspricht dem im Vertrag festgelegten Zweck, da nach Ansicht des Gerichts das Verbot von einer solcher Vermietung sich bereits aus dem Wortlaut des Vertrages ergebe.
Der Kläger legte eine Berufung ein, doch das Stadtgericht bestätigte die Entscheidung des Bezirksgerichts. Darüber hinaus fügte es hinzu, dass „der Wohnbedarf nicht nur aus der Übernachtungsmöglichkeit, sondern aus gesamtem Komplex der Befriedigung der Bedürfnisse eines Menschen, sowohl auf materieller als auch auf psychischer Ebene, besteht“. Dienstleistungen ähnlich Airbnb sollten dann als Beherbergungsdienstleistungen betrachtet werden. Nach Ansicht des Berufungsgerichts hätte die Beklagte die Klage sogar gemäß § 2291 des Bürgerlichen Gesetzbuches ohne Kündigungsfrist geben; aus diesem Grund musste sie den Kläger nicht zur Besserung lt. der Kündigung gemäß § 2288 auffordern, wie sie es in diesem Fall tat.
Der Kläger war mit der Entscheidung des Amtsgerichts nicht zufrieden und legte eine Berufung beim Obersten Gericht ein. Auf die meisten Berufungsverfahren ging es jedoch nicht näher ein, da die Vorinstanzen seiner Ansicht nach nicht von der etablierten Entscheidungspraxis abwichen. Es fasste weiter zusammen, dass die Kündigung nicht gegen die guten Sitten verstoße und der Kündigung auch keine Aufforderung zur Behebung der mangelhaften Zustände vorausgehen müsse. Dabei ging es näher auf die Frage ein, ob die Überlassung einer Wohnung über Plattformen wie Airbnb einen dem Mietzweck zuwiderlaufenden Gebrauch der Wohnung darstellt. Laut dem Obersten Gericht erlegt das Gesetz dem Mieter Pflichten auf, deren Verletzung einen Kündigungsgrund darstellen kann. Zu diesen Pflichten gehört unter anderem auch die Verpflichtung, die Wohnung ordnungsgemäß und mietvertraglich zu nutzen.
Einen besonders schwerwiegenden Verstoß gegen diese Pflicht stellt auch die Vermietung einer Wohnung an Dritte über Plattformen wie Airbnb dar. „Voraussetzung des Mieterschutzes ist, dass der Mieter die gemietete Wohnung oder das gemietete Haus zur „Sicherung des Wohnbedarfs“ verwendet…“ – also zur bereits erwähnten umfassenden Versorgung der Bedürfnisse einer Person, sowohl auf materieller als auch auf psychischer Ebene.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches gelten nicht als Wohnen solche Zwecke, die „der Erholung oder einem anderen erkennbar kurzfristigen Zweck dienen“, also eine Situation, in der die untergebrachte Person „ihren Wohnbedarf auf andere Weise befriedigt (anderswo eine Wohnung hat)“.
Es handelt sich um eine grundlegende Entscheidung des Obersten Gerichts zu Fragen der Bereitstellung von Wohnungen über Dienstleistungen wie Airbnb und dem Konflikt dieser Dienste mit dem Zweck des Mietvertrags, der dessen Kündigung rechtfertigt. Für die Praxis ist es insbesondere deshalb von Bedeutung, weil es klarstellt, dass kurzfristige Vermietungen mit dem Mietzweck, der dem Wohnen dienen soll, nicht vereinbar sind, sofern
im Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.
Diese Entscheidung kann einer der ersten Schritte zur Einführung eines Gleichgewichts auf dem Wohnungsmarkt und dem Markt für Unterkünfte und andere Freizeitdienstleistungen sein.